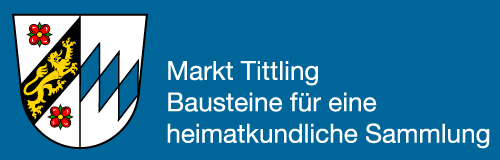Unser Gebiet war einige Jahrhunderte lang Grenzgebiet zum Hochstift Passau („Bistum“) und zu Böhmen.
Auf bayerischer Seite entstanden eine Vielzahl von Burgen zum Schutz des Herrschaftsgebiets. Bei uns waren dies Tittling (erbaut 1280), Hohenwart (vor 1222), Haus im Wald (1248) und Eberhardsreuth (1263).
Als Mitte des 14. Jahrhunderts der bestehende Handelsweg Passau – Tittling – Grafenau als Transportweg für Salz (Gulden Straß) nach Böhmen aufgewertet worden ist, kamen in dieser Zeit weitere Burgen im Abschnitt Tittling – Grafenau zum Schutz hinzu: Dießenstein (1347), Bärnstein bei Grafenau (1347), Saldenburg (1368) und Englburg (1397). Dadurch wurde auch der Schutz der Besucher bei den Märkten in Tittling erhöht.

Über die ehemalige Burg Hohenwart, unmittelbar am damaligen Handelsweg Richtung Grafenau gelegen, gibt es wenig gesichertes Wissen. Sie stand an exponierter Stelle mit weiter Sicht in alle Richtungen. Die Anhöhe auf der sie stand, heißt noch heute Schlossberg. Ein Name, der schon 1827 in einem Plan genannt wird. Heute lässt sich noch der östliche, muldenartige Weg zur früheren Burg erkennen.
Über ihre Existenz gibt es nur wenige Indizien. Es gibt aber Sagen über diese Burg im „Schachert“. Sie handeln von verborgenen Schätzen beim Hohenwarter Schloss und furchtlosen Menschen, die nach ihnen suchten, aber letztlich scheiterten. Für Max Peinkofer waren Sagen „das ewige Gedächtnis des Volkes“.

Von Peinkofer stammen viele Erkenntnisse und Überlegungen zu Hohenwart, Quelle für viele Veröffentlichungen über diese untergegangene Burg.
Einen ersten gesicherten Nachweis gab es im Sommer 1943, der auch Peinkofer elektrisierte. Beim Erweitern eines Steinbruchs Richtung Osten stießen die Arbeiter auf Reste der Burg. Peinkofer spricht von einem Turmstumpf aus mächtigen Quadern, einer 20 Meter langen Mauer (siehe Foto) und weiteren Teilen der Burganlage. Ihn faszinierte ein großer romanisch-gotischer Schlüssel. Einen Säbel, Werkzeuge, Kohlen und Schlacke warf man achtlos beiseite.
Bei den fortschreitenden Arbeiten wurden die Reste der Burg abgetragen und landeten teilweise im Abraum. Es wird vermutet, dass Steine der Burg schon früher in Hohenwart beim Bau der Bauernhöfe verbaut worden sind.
Die Herren der Burg Hohenwart erscheinen auch in Urkunden. Im Jahr 1222 wurden die Brüder Heinrich und Konrad von Hohenwart mit der kaiserlichen Reichsacht belegt, Sie hatten mit den Herren von Hals dem Hochstift Passau großen Schaden zugefügt, während der Fürstbischof Ulrich II am 5. Kreuzzug im Heiligen Land teilnahm, wo er Ende 1221 in Ägypten verstarb.
Im Jahr 1248 wird ein Konrad von Hohenwart als Dienstmann der Herren von Hals genannt. Ein Jahr später findet sich ein Heinrich von Hohenwart als Dienstmann des Passauer Fürstbischofs.
Im Jahr 1310 besaß die Burg Hohenwart ein Johann von Jahenstorf. 1387 taucht in einer Urkunde ein Friedrich von Hohenwart auf, der in dieser Zeit Richter in Schärding war. Dann verliert sich die Spur derer „von Hohenwart“ zu Tittling. Laut Peinkofer könnte ein Bauernhof in Trautmannsdorf, der an der Stelle des heutigen Gasthauses stand, der Wirtschaftshof der Burg Hohenwart gewesen sein.
Er nimmt an, dass die Hussiten Anfang des 15. Jahrhundert die Burg zerstört haben, wahrscheinlich zwischen 1431 und 1433. Die zeitliche Einordnung der Zerstörung der Hohenwarter Burg erscheint plausibel. Jedenfalls ist die Burg Hohenwart nicht mehr auf dem Plan von Philipp Apian von 1568 eingezeichnet, der alle anderen Burgen in unserem Bereich akribisch dargestellt hat.
Zur Zeit der Hussitenkriege (1419 – 1434) wird es auf dieser Handelsstraße und an Markttagen in Tittling für einige Zeit ruhiger zugegangen sein. Aber der Tittlinger Bürgerschaft gelang es immer wieder, nach Kriegswirren, Großbränden und anderen Notzeiten positiv in die Zukunft zu schauen und entschlossen anzupacken.
HZ 07.2025